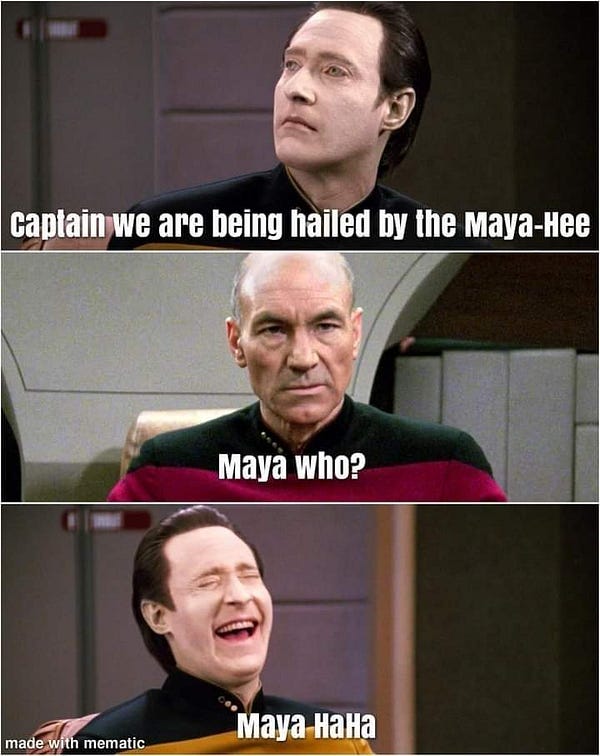Geld, Geld, Geld
Kultur & Kontroverse ist ein Newsletter, in dem ich über kulturelle Konflikte der Gegenwart schreiben möchte. Die spannendsten Konflikte finden heute im medienübergreifenden, oft digitalen Getümmel statt. Wer sich für Streitereien und Debatten über Bücher, Filme, Musik, Serien und viele andere Dinge, die uns entzweien, interessiert, der ist hier an der richtigen Stelle.
Wenn euch dieser Newsletter gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Man kann ihn auch finanziell unterstützen und zwar für nur 4 Euro Pro Monat, das ist nur ein Euro pro frischem Newsletter.
Wer zahlt für den Protest?
Nachdem die Bonusausgabe dieses Newsletters am Freitag viele Leser*innen verstört und amüsiert zurück gelassen hat, widmen wir uns diesmal wieder den ernsten Fragen des literarischen Lebens. Mehr oder weniger zufällig geht es vor allem um Geld. Am Dienstag hatte ich über die Aktion Fair Lesen geschrieben, die sich gegen neue Lizensierungsregeln für die Ausleihe von eBooks in Bibliotheken richtet. Dabei hatte mich vor allem interessiert, wer für die aufwendige Aktion bezahlt hat. Ein Telefonat hat ergeben, dass an den Kosten die Unterzeichnenden, aber auch Institutionen, die nicht unterzeichnet haben, beteiligt waren. Der Börsenverein, der auf der Internetseite als Dienstanbieter geführt wurde, war es also nicht (danach wurde auf Twitter gefragt). Zudem sind die in den Mediendaten der Zeitungen angegebenen Kosten für etwa eine Doppelseite anscheinend höchst verhandelbar. Jedenfalls scheint die Aktion weniger kostspielig gewesen zu sein, als ich dachte. Das alles ist interessant, und die Diskussion wird (auch hier) weitergehen. Was aber auf jeden Fall deutlich geworden ist: Die Panik bei den Verlagen, was die Einbußen durch die Onleihe angeht, ist real und groß und es zeichnet sich ab, dass der Konflikt mit einiger Härte geführt werden wird. Mediengeschichtlich ist diese Entwicklung vor allem deshalb spannend, weil sie die Bibliotheken als Akteure im literarischen Feld plötzlich mit einer neuen Rolle ernstzunehmender Konkurrenz ausstattet.
Wer zahlt für die Kunst?
Um Geld und Kunst ging es auch in der neuen Folge unserer Podcast Kooperation "Lakonisch Elegant trifft 54books", die man hier nachhören kann. Was ich besonders interessant fand, war die Frage, wie Geld immer am Text mitschreibt. Die Redensart "Wes Brot ich ess, des Lied ich sing", die im Wesentlichen das gesamte Forschungsfeld der Literatursoziologie beschreibt, ist für alle Bereiche des literarischen Lebens einschlägig. Man kann dieser Frage nicht ausweichen, weil immer jemand für den Text bezahlt, und damit immer Anforderungen einhergehen. Diese Probleme sind natürlich nicht neu, aber mit der Digitalisierung haben sich neue Formen des Geldverdienens aufgetan (während alte versiegt sind). Und so verändert sich auch die Frage, wessen Lied man singen muss, um an wessen Brot zu kommen. Um Geld geht es auch in der aktuellen Ausgabe von Hanser Rauschen, wo ein paar spannende konkrete Fragen zum Zusammenhang von Kunst und Wirtschaft beantwortet werden. Hier wird z.B. aufgedröselt, welcher Euro von einem verkauften Buch wohin geht. Ich war teilweise ganz schön überrascht.
Wer zahlt für die Nachrichten?
Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Sterben von Lokalzeitungen in den USA am Beispiel des Hawk-Eye in Burlington, Indiana. (Bitte nicht aufhören zu lesen, es ist spannend!) Der Niedergang des Lokaljournalismus ist ein weltweites Problem, das vor allem mit der Digitalisierung und ihrer Umschichtung von Werbeeinnahmen einhergeht. Gleichzeitig wird dieser Niedergang aber auch mit einer steigenden Dezentralisierung und Ent-Lokalisierung von Gesellschaften in Verbindung gebracht. Dann mischt sich auch ein teilweise eigentümlich nostalgisch-kulturkritischer Ton in die Berichterstattung. Jeder trauert um das kleine Lokalblatt, aber keiner will es lesen. So auch in der Story von Elaine Godfrey:
"Wenn Menschen den Niedergang kleiner Zeitungen beklagen, neigen sie dazu, die wichtigsten Geschichten zu betonen, die nicht mehr aufgedeckt werden: politische Korruption, Skandale in Schulbehörden, Anhörungen in Bauämtern, Fehlverhalten der Polizei. Darüber machen sie sich zu Recht Sorgen. Aber oft werden die alltäglicheren Geschichten übersehen, die zuerst verschwinden, wenn eine Zeitung ihre Ressourcen verliert: Geschichten über das jährliche Teddybär-Picknick im Crapo Park, die Bürgerversammlung über das neue Schwimmbaddesign und die Traktorspiele während der Denmark Heritage Days.
Diese Geschichten sind das Bindegewebe einer Gemeinschaft; sie machen die Menschen mit ihren Nachbarn bekannt und ermutigen die Leser*innen, einander zuzuhören und sich in sie einzufühlen. Wenn dieses Gewebe zerfällt, verrottet etwas Lebenswichtiges. Wir halten nicht oft inne, um darüber nachzudenken, wie sich die Menschen durch den Zusammenbruch einer Zeitung fühlen: weniger verbunden, mehr allein. In dem Maße, wie die lokalen Nachrichten zerbröckeln, bröckelt auch unsere Verbindung zueinander."
Im Artikel wird die Lokalzeitung gegen lokale Facebook-Gruppen ausgespielt, die eher schlecht als recht das Nachrichtenvakuum ausgleichen sollen, das durch das Verschwinden von Lokalzeitungen entstanden ist. Natürlich steht in solchen Gruppen, die ad-hoc gegründet und kaum kuratiert werden, viel Blödsinn; natürlich kommen auch hier viele unangenehme soziale Dynamiken zustande - es sind immerhin Nachbarschaften. Es ist aber schwer einzuschätzen, worum es in dieser Abwertung digitaler Foren gehen soll. Geht es um den mangelnden redaktionellen Ethos solcher Gruppen? Dann wäre die grundsätzliche Frage, warum 16.000 Menschen, die in Burlington, wo die lokale Zeitung gestorben ist, in der Nachbarschaftsgruppe herumhängen, nicht einfach gemeinsam eine Redaktion finanzieren, die dahin kommt, wo auch lokale Öffentlichkeit stattfindet, nämlich auf Facebook. Ohne die Kosten für Druck und Zirkulation könnte eine solche Gruppe eine schlagkräftige Lokalredaktion finanzieren, die die Nachrichten dann aber auch im Austausch mit der digitalen Öffentlichkeit produziert.
Wer verdient am Untergang?
Der Untergang von Lokalzeitungen in den USA hat noch eine düsterere Komponente. Es handelt sich nämlich nicht allein um eine quasi zwangsläufige Entwicklung der Mediengeschichte, sondern auch um einen Fall ethisch fragwürdiger Geschäftspraxis. Offenbar ist es ein ausgesprochen lukratives Geschäftsmodell, Lokalzeitungen aufzukaufen und so lange kaputtzusparen und die Preise zu erhöhen, bis auch der letzte Kunde sein Abo gekündigt hat. Die Könige dieser Praxis sind Alden Global Capital. Im amerikanischen Mediensystem gibt es gerade kaum eine verhasstere Firma. Letztes Jahr titelte Vanity Fair "The Hedge Fund that bleeds Newspapers dry bow has the Chicago Tribune by the Throat". Die Geschichte von Alden und ihrer Machenschaften werden in dieser spannenden Reportage erzählt. Und auch dort werden die konkreten politischen und gesellschaftlichen Folgen beschrieben, die das Verschwinden von Zeitungen zur Folge haben kann:
"Untersuchungen zeigen, dass das Verschwinden einer Lokalzeitung in der Regel mit einer geringeren Wahlbeteiligung, einer stärkeren Polarisierung und einer allgemeinen Erosion des bürgerlichen Engagements einhergeht. Fehlinformationen breiten sich aus. Die städtischen Haushalte blähen sich auf, ebenso wie Korruption und Dysfunktion."
Die guten Texte
Im New Yorker findet sich ein langes Porträt über Paul McCartney. Ebenfalls im New Yorker: Eine Story über das eigentümliche Angebot der Firma Masterclass. Und, Freundin und Kollegin Sonja Lewandowski hat einen bestürzenden und brillanten personal essay über das Turnen geschrieben.