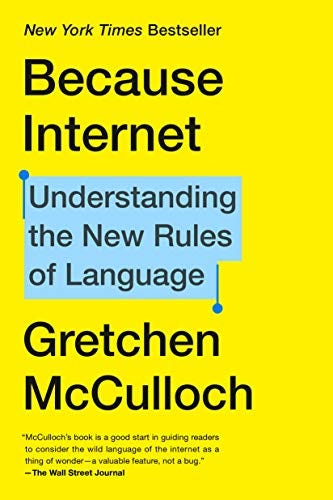Elitepartner, aber fürs Gehirn
Kultur & Kontroverse ist ein Newsletter, in dem ich über kulturelle Konflikte der Gegenwart schreiben möchte. Die spannendsten Konflikte finden heute im medienübergreifenden, oft digitalen Getümmel statt. Wer sich für Streitereien und Debatten über Bücher, Filme, Musik, Serien und viele andere Dinge, die uns entzweien, interessiert, der ist hier an der richtigen Stelle. Dieser Newsletter hat (noch) keine feste Form. Er ist mein Experimentierfeld für ein gegenwartsnahes Schreiben über Kultur. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.
Belletristische Megafauna
Im Tagesspiegel wird Michael Köhlmeiers neuer Roman Matou als "Mammutbuch" bezeichnet. Dort heißt es: "Die fast 1000 eng bedruckten Seiten enthalten im Grunde mehrere Romane." Ich las das letzte Woche mit einer gewissen Melancholie, denn auf meinem Schreibtisch liegt drohend der aktuelle Dickroman eines amerikanischen Großschriftstellers und harrt seiner Besprechung; es sind über 800 Seiten. Offenbar hat mein langer Atem für "Mammutbücher" ziemlich nachgelassen, denn ich denke inzwischen oft, dass in jedem 1000-Seiten Buch ein vierhundertseitiges Buch steckt, das man lieber in der Schublade gelassen hätte. Was ich an der Sache aber spannend finde, ist, wie der Umfang eines Buches nach wie vor als Bewertungskriterium zumindest unterschwellig eine Rolle spielt. Das kann auch in die andere Richtung ausschlagen (die erlesene Prosa der schlanken Novelle etc.), aber vor allem scheint es nach wie vor eine Faszination mit dem großen Wurf zu geben. Anders kann man sich die gar nicht so seltene Evokation des Mammuts als Vergleichsobjekt kaum erklären.
Als Mammutbuch bezeichnet wurden in den letzten Jahren im Feuilleton unter anderem Hans Henny Jahnns Fluss ohne Ufer, Arno Schmidts Zettel's Traum, oder Elements of Architecture von Rem Koolhaas. "Mammutromane" wiederum sind: Guntram Vespers Frohburg, Haruki Murakamis 1Q84, Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit natürlich, selbstredend auch Robert Musils Mann ohne Eigenschaften und Heimito von Doderers Die Strudlhofstiege. Desweiteren: Roberto Bolaños 2666, Ayn Rands Atlas Shrugged, Ulysses von James Joyce und immer wieder Unendlicher Spaß von David Foster. Die Liste ließe sich lange vorsetzen und irgendwo in diesem Cluster von Mammut-Vergleichen steckt eine interessante diskurssemantische Studie zur Kanonisierung dicker Bücher, auch in Bezug auf die Frage danach, inwiefern die Faszination mit dem Riesenbuch stark gegendert ist.
Spinbot: Judgement Day
Ich komme nicht darüber hinweg, wie witzig ich diese Geschichte finde. Offenbar sind weltweit in wissenschaftlichen Zeitschriften tausende gefälschte Artikel veröffentlicht worden, die geklautes Material durch ein Programm wie Spinbot haben laufen lassen. Spinbot ersetzt in einem Text Worte durch Synonyme, wie das ein etwas geschickterer Plagiator per Hand machen würde - nur eben nicht so geschickt, dass die Texte danach nicht extrem seltsam klingen. Wie genau es dazu kommen konnte, dass entsprechende Artikel in solchen Mengen in teilweise renommierten Zeitschriften landeten – darüber würde ich gerne noch weitere Artikel lesen. Im Kontext der extremen Überproduktion wissenschaftlicher Publikationen ist diese Geschichte natürlich ein weiterer Indikator für eine Misere, die durch eine neoliberale, konkurrenzdurchwirkte Wissenschaftskultur und profitorientierte Verlage herbeigeführt wurde. Auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um die Polemik gegen die geisteswissenschaftliche Publikationsindustrie noch einmal hervorzuholen, die Christian Demand auf den ersten Seiten seiner Merkur-Kolumne von 2017 entwickelt hat. Vor allem aber habe ich mir einen Spaß daraus gemacht, den Spinbot ein paar berühmte erste Sätze der Weltliteratur umformulieren zu lassen. Enjoy:
Jane Austen: “It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.”
Spinbot: “It is a reality generally recognized, that a solitary man possessing a favorable luck, should be in need of a spouse.”
Virginia Woolf: “Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.”
Spinbot: “Mrs. Dalloway said she would purchase the blossoms herself.”
Sylvia Plath: “It was a queer, sultry summer, the summer they electrocuted the Rosenbergs, and I didn’t know what I was doing in New York.”
Spinbot: “It was a strange, steamy summer, the mid year they shocked the Rosenbergs, and I didn't have the foggiest idea what I was doing in New York.”
Hunter S. Thompson: “We were somewhere around Barstow on the edge of the desert when the drugs began to take hold.”
Spinbot: “We were somewhere near Barstow on the edge of the desert when the medications started to grab hold.”
Man könnte ewig weitermachen, aber dieser Newsletter tendiert eh schon zu Überlänge. Postet eigene Vorschläge auf Twitter unter #spinbotclassics und ich teile die besten in der nächsten Ausgabe.
Elitepartner, aber fürs Gehirn
Gerade wurde mir bei Facebook seit längerem mal wieder eine Werbung für Blinkist angezeigt. Es handelt sich um eine App, die Sachbücher zusammenfasst, damit sich der gestresste moderne Mensch einen schnellen Überblick über die Essenz des wichtigen Wissens verschaffen kann. An der Idee des Programms erscheint mir eigentlich wenig auszusetzen, obwohl sie aus der Perspektive eines verunsicherten Bildungsbürgertums wie der Inbegriff digitaler Oberflächlichkeit wirken muss. Was mich aber jedes Mal irritiert und irgendwie auch amüsiert, ist die widersprüchliche Mischung aus Startup-Sprech und Bildungsdünkel in der Außendarstellung der App. Die ständigen Verweise darauf, wie viel Bill Gates lesen würde, verbunden mit den intellektuellen Elite-Partner-Vibes, die - was ja fast rührend altmodisch erscheint - versprechen, dass es sich um eine App handelt, die von vielen Intellektuellen verwendet wird: Hustle-Culture meets Academia-Cosplay.
Rezensionsbomben
Das Videospiel Life is Strange: True Colors wurde zum Opfer einer "Review Bomb", das heißt, es wurde auf Online-Plattformen wie Metacritic systematisch mit einer Flut von schlechten Rezensionen überzogen. Review Bombs gehören zu den neuen Erscheinungsformen der digitalen ästhetischen Kommunikation. Oft geht es dabei um politische Fragen. Das Spiel The Last of Us, Part II etwa wurde unter anderem deshalb zum Opfer einer Review Bomb, weil ein Teil der Gaming-Community wütend über die Inklusion queerer Figuren war. Im Fall von Life is Strange waren es vor allem Rezensionen aus China, die sich an einer Tibetischen Flagge im Spiel gestört haben. Christian Huberts hat zu diesem Anlass hier ein paar spannende Artikel zur kulturellen Soft Power gesammelt, die von der chinesischen Regierung eingesetzt wird, um Druck auf Kunstwerke auszuüben.
Die ästhetische Elite des Sitzenbleibens
Apropos Videospiele - noch ein Gedanke, den ich am Wochenende hatte, als ich das extrem gute Spiel Bioshock Infinite zuende gespielt habe (hier eine Rezension, Achtung brutal): Es handelt sich um eines der narrativen Kunstwerke, bei dem man danach ins Internet geht und googelt, was das Ende bedeutet, um dann festzustellen, dass sich um die Rätsel der Erzählung herum sehr schnell eine riesige Menge an Diskurs sedimentiert hat. Ich finde das eigentlich sehr schön - ein gutes Beispiel, wie konkrete ästhetische Kommunikation aussehen kann, wenn man den Snobismus des Hochkultur-Segments gegen Plotfragen hinter sich lässt. Plötzlich ist man damit beschäftigt hunderte Kommentare unter einem Youtube-Video zu lesen, in denen das Ende eines Spiels diskutiert wird.
Allerdings wurde ich bei dieser Gelegenheit auch darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Post-Credit-Scene gibt, also eine kurze Szene, die erst gespielt wird, nachdem die unmäßig vielen Namen der an der Produktion beteiligten abgespult wurden. Und diese Szene soll in Bioshock Infinite alles noch einmal in einem anderen Licht etc. Ohne diesen Diskurs schon aufgearbeitet zu haben, muss ich an dieser Stelle sagen: Ich glaube, ich hasse Post-Credit-Scenes. Die Vorstellung, dass es eine mehr oder weniger versteckte Botschaft an diejenigen gibt, die über das kulturelle Praxiswissen verfügen, dass man im Kino oder vor dem TV noch sitzen bleiben muss, um das Narrativ vollständig zu verstehen, ist eine seltsam faule Art, Distinktionsgewinn zu erzeugen (inzwischen handelt es sich ja um eine beliebte Strategie von Blockbuster-Filmen, den nächsten Teil der Franchise anzuteasern). Aber dahinter steht auch die Vorstellung, dass man die Rezipient*innen zur Geduld und zum Respekt vor der Produktion erziehen muss, indem man sie zum Stillsitzen zwingt. Das sind wie gesagt nur spontane Gedanken zu einer irritierten Intuition. Es könnte gut sein, dass ich falsch liege. Falls jemand gute Essays dazu kennt oder eigene Einschätzungen hat, wäre ich daran interessiert.
Die guten Texte
Freund und Kollege Simon Sahner hat einen sehr spannenden Text darüber geschrieben, warum die spielerische Kommunikation auf Twitter manchmal aus der Außenperspektive verwirrend und abstoßend wirken kann. In der New Republic findet sich ein erschreckender und plausibler Artikel darüber, wie Tucker Carlson zu der Figur wurde, die er ist. Und im Atlantic kann man einen tollen Artikel über die Kommodifizierung von Aktivismus lesen, wie sie sich etwa auf der vielbeachteten Met-Gala 2021 gezeigt hat.
Die guten Tweets
[tweet https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1437428054461190148]