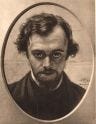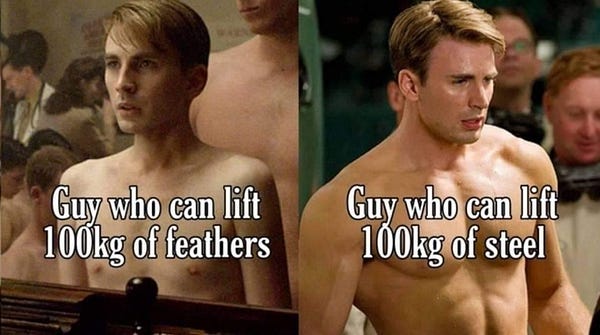Aufmerksamkeitsalkohol
Kultur & Kontroverse ist ein Newsletter, in dem ich über kulturelle Konflikte der Gegenwart schreiben möchte. Die spannendsten Konflikte finden heute im medienübergreifenden, oft digitalen Getümmel statt. Wer sich für Streitereien und Debatten über Bücher, Filme, Musik, Serien und viele andere Dinge, die uns entzweien, interessiert, der ist hier an der richtigen Stelle.
Man kann diesen Newsletter finanziell unterstützen und zwar für nur 4 Euro Pro Monat, das ist nur ein Euro pro frischem Newsletter.
Autokratie als Alkohol
Während die Sondierungsgespräche der Parteien - wie nach jeder Wahl - einen Haufen journalistische Hofberichterstattung und Teeblattlesen erzeugen, ist ein klarer Verlierer schon lange ausgemacht: Die Sozialen Medien und insbesondere Twitter. Im Spiegel wurde in einem langen mahnenden Artikel die Frage gestellt: “Wird das Medium zu einer Gefahr für die Demokratie?” Im Text wird mit großem Mitleid darüber geschrieben, wie schwer es Politiker wie Armin Laschet auf Twitter haben, etwa als sein peinlich anmutender Auftritt mit Elon Musk verspottet wurde. Das sei natürlich alles aus dem Kontext gerissen gewesen. Da könne man verstehen, wenn manch ein Politiker von Twitter geflüchtet sei: “Nicht erst seit den Erfahrungen, die Armin Laschet in diesem Wahlkampf machen musste, stellt sich die Frage: Wer kann, wer will sich diesen einander widersprechenden Anforderungen weiter aussetzen?”
Diese Art der händeringenden Kulturkritik ist bekannt. Sie richtet sich am Ende allerdings nicht gegen eine Plattform, sondern eine Öffentlichkeit, die diese Plattform eben nutzt und die den etablierten Medien zutiefst suspekt zu sein scheint. Beschimpft werden sollen Politiker offenbar nur von Profis, also dem Spiegel oder der Bild, nicht von den unberufenen Massen auf Social Media. Dabei gerät zuweilen aus dem Blick, wie stark etablierte Gatekeeper, Politiker und Medien an diesem angeblich toxischen Verhalten selbst beteiligt sind. Ausgerechnet Ulf Poschardt wird im Artikel immer wieder als Experte zitiert. Unter anderem mit Sätzen wie diesen: “Die Schamlosigkeit, mit der manche Linke auf Twitter total privilegiert herummoralisieren, ist so beklemmend und so reaktionär, das ist schwer auszuhalten.” Oder: “Ich übergebe mich schon fast, wenn ich darüber nachdenke. Was Bourgeoiseres und Selbstgerechteres gibt es gar nicht.” Poschardt und seine Zeitung bespielen allerdings virtuos wie kaum ein Einzeluser die toxischen Aspekte der digitalen Öffentlichkeit, nur, um dann von der Kanzel einer medialen Machtposition über die Verrohung des Diskurses zu schimpfen.
Der Artikel im Spiegel ist nur ein Beispiel für einen Prozess, der sich schon länger abzeichnet: Die Stimmung gegen die Sozialen Medien hat sich gedreht. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht irgendwo ein warnender Artikel erscheint. Im Atlantic etwa wurde Facebook gerade als die größte Autokratie der Welt bezeichnet. (Während ich das schreibe, ist Facebook übrigens immer noch in einem bedrohlich langen Blackout befangen.) Verbunden war diese Diagnose mit der Aufforderung, die Plattform wie eine feindselige ausländische Macht zu behandeln. Im New Yorker wiederum evozierte Chris Haynes die digitale Öffentlichkeit als eine Schreckenslandschaft des gegenseitigen Beobachtens und Belauschens. Dank dem Internet sind wir alle Wüstenfüchse mit riesigen Ohren, die alles hören, was (über sie gesagt) wird. Damit sind die Topoi einer politischen und öffentlichkeitstheoretischen Kritik für diesen Monat abgedeckt. Was noch fehlt, ist der therapeutische Diskurs, in dem die Sozialen Medien als Gefahr für das psychische Wohl von Individuen erscheinen. Deshalb hier noch ein Text, der sie mit Alkohol vergleicht, mit "Aufmerksamkeitsalkohol".
Der Kaiser schreibt nicht gut
William Gaddis war ein amerikanischer Schriftsteller, dessen Romane (The Recognitions, JR) als Klassiker der experimentellen Prosa gelten. Jonathan Franzen beschrieb sie in seinem Essay Mr. Difficult. William Gaddis and the problem of hard-to-read books von 2002 als Inbegriff der schweren modernistischen Literatur, von der er sich abwenden wolle. Jetzt sind die beiden großen Romane von Gaddis neu aufgelegt worden, was Adam Mars-Jones im London Review of Books zu einem langen, tiefgehenden Take-Down motiviert hat. Die Romane seien zwar Denkmäler, aber weniger "im Sinne einer literarischen Leistung". Stattdessen erinnerten sie an eine bestimmte Vorstellung von Literatur des 20. Jahrhunderts, insbesondere, was die "Arbeitsteilung zwischen Autor und Leser" betrifft. Gemeint ist das, was Franzen in seinem Essay bereits als das "Status Modell" bezeichnet hatte: Die Autor*innen schenken dem eingeweihten Publikum ihre schweren Meisterwerke und das Publikum muss hart arbeiten, um die genialen Bücher entschlüsseln und genießen zu können. Mars-Jones zeigt nun anhand eines Close-Readings, dass diese Arbeit auch, und vielleicht vor allem, das Resultat von schriftstellerischem Unvermögen ist.
"Here readers are assumed to need the help of crude signposts, but in much of the book obstacles to understanding are placed in their way. ‘Basil Valentine cupped his hands to light a cigarette, for the one he had held up with a match was quivering.’ The scanning eye, needing to find a referent for ‘one’, fastens first on the singular noun ‘cigarette’, discards it when the mental picture of a match holding up a cigarette proves nonsensical and settles by a process of elimination on the intended meaning, ‘one’ of Basil’s hands. Readers don’t mind paying attention as long as attention has been paid to them, their path through the book swept rather than boobytrapped. But this sentence, like thousands of others, needs to be read twice for basic information – no writer who had given it even a single scrupulous reading would leave it as it stands."
Wichtig finde ich vor allem den Satz: "Den Lesern macht es nichts aus, aufmerksam zu sein, solange ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wird", der mein Unbehagen in Bezug auf viel modernistische 'schwere' Literatur gut zusammenfasst. Man erstarrt vor dem Prestige des arbeitsaufwändigen Meisterwerks und traut sich nicht zu sagen: Der Kaiser schreibt nicht gut.
Leseliste Sexualpolitik
Der Zusammenstoß zwischen der Autorinnen Natasha Lennard und Maggie Nelson ist schon etwas länger her. Lennard hatte Nelson Anfang September vorgeworfen, dass sie in ihrem neuen Buch On Freedom eines ihrer Essay vollkommen falsch wiedergegeben habe. Lennards Text von 2017, den man hier nachlesen kann, beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle Sexualpolitik in progressiven Bewegungen spielen kann - eine Frage, die seit einiger Zeit im Mittelpunkt einer vitalen Diskussion steht. Auf Twitter meldete sich etwa Yasmin Nair zu Wort, die wiederum kritisierte, dass Lennard eines ihrer Essays falsch zitiert habe. Der Text von 2015 trägt den Titel Your sex is not radical und beschäftigt sich mit dem Problem, dass sexuelle und politische Praxis zu oft verwechselt werden würden: "How many people you fuck has nothing to do with the extent to which you fuck up capitalism."
Eine weitere Autorin, die sich auf Twitter geäußert hat, ist Amia Srinivasan, deren Buch The Right to Sex ich gerade gelesen habe und unbedingt empfehlen kann. Als Einstieg sollte man ihren vielbeachteten Essay Who lost the Sex Wars im New Yorker lesen. Einen Überblick über die Debatte verschafft auch diese Doppelrezension, die neben Srinivasans Buch auch auf Tomorrow Sex Will Be Good Again. Women and Desire in the Age of Consent von Katherine Angel eingeht.
Die guten Texte
Im letzten Jahr wurde die Welt in Aufregung versetzt, weil unzählige Menschen scheinbar aus dem Nichts Samen aus China zugeschickt bekamen. Diesem Rätsel widmet sich diese Geschichte. Einen extrem erschreckenden Bericht liefert Nancy Jo Sales, die eines Tages damit konfrontiert wurde, dass ein ehemaliger Lehrer einen sexualisierten Übergriff gestanden hat, an den sie sich nicht erinnern kann. Und ein spannender Text, der sich mit der Frage beschäftigt, ob Triggerwarnungen überhaupt funktionieren.
Die guten Tweets
[tweet https://twitter.com/woodrowwhite/status/1443662959926906894]